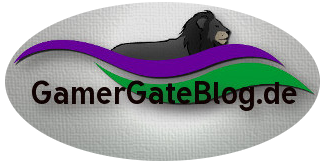Alter Mann brüllt Wolken Hipster an
Immer öfter halten vor allem jüngere Journalisten das Interesse ihrer Leser an der Berichterstattung fälschlicherweise für ein Interesse der eigenen Person. Zuerst ist mir dieser Trend bei Fernsehdokumentationen aufgefallen: In den letzten Jahren hat es sich etabliert, dass diese Formate immer öfter einen Hybriden zwischen Moderator und Sprecher einsetzen, vermutlich um dem Zuschauer einen emotionalen Bezugspunkt zu geben und der Produktion zu Wiedererkennungswert zu verhelfen. Das führt in der Praxis leider dazu, dass ich minutenlang nicht Tansania oder die Provence, sondern einen Fernsehmenschen sehe, der versucht beim Kanufahren oder im Gespräch mit Insektenforschern möglichst spontan und ungeprobt rüber zu kommen. Mal abgesehen von der Frage, was Scripted Reality in Bildungsprogrammen zu suchen hat, verschwendet eine solche Dokumentation die wertvolle Zeit des Zuschauers.
Genauso geht es mir mit vielen Vertretern des „modernen“ Spielejournalismus. Als ich noch ein eifriger Leser von Rock, Paper, Shotgun war – dem allerdings schon 2013 zu dämmern begann, das John Walkers Hang zur Predigt auf Dauer unerträglich sein würde – kam ich zum ersten Mal mit Artikeln von Cara Ellison in Berührung. Wie schon Leigh Alexander ein paar Jahre vor ihr wurde die damals frisch „entdeckte“ junge Autorin auf den üblichen Seiten für ihren „mutigen“ und „innovativen“ Journalismus gelobt. Und genau wie bei Alexander wollte ich ja zumindest wissen, worüber die jungen Leute denn jetzt so aufgeregt waren. Und wie bei der ersten Dame war ich nach der Lektüre eher peinlich berührt, dass so viele Menschen offensichtlich Nabelschau nicht von Spielejournalismus unterscheiden können.
Die Artikel waren voller Sätze wie „Es ist mir wichtig mitzuteilen, das ich jetzt, während ich dieses Spiel spiele, in der lauwarmen Feuchte eines Hinterhofs in Manhattan sitze„, „Während ich aufgewachsen bin habe ich andere Mädchen nicht gemocht. Ich war frauenfeindlich. Waren wir alle.“ oder „Die Galerie ist ein winziges, minimalistisches Studio mit einer kuriosen Bar und einer Retro-Eismaschine im Hintergrund„. Ich weiß nicht, ob es anderen genauso geht, aber wie bei den Fernsehdokumentationen beschleicht mich auch hier der Verdacht, das mir unter dem Vorwand der Berichterstattung Lebenszeit geraubt wird, nur dass ich in diesem Fall nicht am gefühlt einhundertsten Abendessen irgendwo in Nepal teilnehmen sondern mich mit den Adoleszenzdramen einer typischen Vertreterin der Generation „Irgendwas mit Medien“ auseinandersetzen muss. Und da mögen die Kollegen auch noch so viel Lob ausschütten, die haben ja, wie die „Gamers are Dead“-Artikel gezeigt haben, sowieso die Schnauze voll von ihrem Publikum. Warum seid ihr dann eigentlich noch hier? Ach, ich vergaß, bei den „echten“ Journalisten kommt man mit der Kugelfischtaktik nicht so weit, nur im Kultursektor reicht es, wen man sich von Zeit zu Zeit auf die Größe seines Egos (bei „progressiven Meinungsjournalisten“ ca. das 14-fache des ursprünglichen Körpervolumens) aufbläst, damit einen die anderen Schwarmmitglieder weiter ernst nehmen.
Die oben zitierte Cara Ellison bringt ihre Sicht der Dinge so auf den Punkt:
Der Wert eines geschriebenen Werkes hängt von zwei Dingen ab: 1) Der Fähigkeit des Schreibenden, eine bestimmte Bedeutung effektiv auszudrücken 2)Der Fähigkeit des Lesers, sich die Mühe zu machen, dieser Bedeutung entgegen zu gehen. 2) wird nicht sehr oft untersucht.
Miss Ellison versteht offensichtlich das Konzept einer „schreibenden Zunft“ nicht vollständig, nach unzähligen Teilnahmeurkunden scheint sie anzunehmen, dass es auch im richtigen Leben nach der Uni noch ausreiche, wenn nur der Autor selbst seine Ergüsse versteht. Und in ihrer Selbstüberschätzung behaupten Leute wie sie dann gerne noch, das sei halt „Gonzo-Journalismus“, vermutlich weil sie mal einen Film mit Johnny Depp gesehen haben. Hunter S. Thompson würde kotzen. Irgendwer muss diesen Oberstufenlyrikern mit Weltrettungskomplex mal mitteilen, dass ihre Person und ihr Privatleben dem Kunden, denn nichts anderes ist der Leser, in der Regel reichlich egal sind. Journalismus bedeutet nicht, dass man sich ein Thema vornimmt und dann den Artikel damit verbringt, über die eigenen Befindlichkeiten in diesem Zusammenhang zu weinen. Dafür gibt es Tumblr! Diese Menschen wollen einfach nicht verstehen, wie Nischenpresse funktioniert – sie existiert nur dann erfolgreich, wenn die Nische auch Interesse an den angebotenen Inhalten hat. Ein Metal-Magazin, dessen Redakteure die ganze Zeit schreiben, wie viel besser sie Zwölftonmusik finden, wird sich am Markt nicht allzu lange halten. Einem Magazin für Computerspiele, das überwiegend Artikel über moderne Kunst veröffentlicht (der Rest der Artikel dreht sich dann darum, was für herzlose Monster die Leser sind), wird es ähnlich ergehen.

Ich habe über Prison Architect geschrieben, meine Gedanken drehen sich um Focault, Simulation und das Weiß-Sein / Quelle. Twitter
Und doch, gerade gestern hat die Veröffentlichung von Prison Architect einem Journalisten wieder mal Gelegenheit gegeben, genau das zu tun: Der Kunsthistoriker Will Partin legt auf killscreen.com seine ganz eigene Sicht auf den erfolgreichen Mix aus knallhartem Management und Satire dar. Er bemängelt vor allem fehlenden Realismus der Gefängnissimulation: Es fänden zu viele Aufstände und Ausbrüche statt, das erzeuge ein falsches Bild und vor allem käme das Thema der Hautfarbe der Insassen viel zu kurz. Es folgt ein ellenlanger Diskurs über Focault, Gefängnisarchitektur und Unterdrückung. Und Hautfarbe. Später fragt Partin noch, warum die Gefängnisbehörde im Spiel neben Alkohol- und Drogenentzug für die Häftlinge nicht auch Kurse in „kultureller Heilung“ anbieten könne. Einen Vorschlag, wie so etwas spielmechanisch umzusetzen wäre, bleibt er schuldig – falls es der geneigte Leser vor lauter Kopfschütteln vergessen haben sollte: In dem Artikel ging es ursprünglich um ein satirisches Videospiel. Und Hautfarbe. Irgendwie. Der Artikel hat mich dann wieder an das Review von Tropico 5 erinnert, in dem der Redakteur der Seelenpein Ausdruck gab, die ihn überkam, nachdem das Spiel ihn zu Grausamkeiten gegen seine virtuellen Untertanen gezwungen hatte. Ich könnte heulen vor Unterdrückung!
Es liegt mir fern, dieser Art von persönlichem Ausdruck ihre Existenzberechtigung abzusprechen. Mein Erstaunen bezieht sich eher darauf, dass diese Herrschaften in ihrer blasierten, arroganten Art glauben im Besitz einer Wahrheit zu sein, die sie von vielen Pflichten befreit: Im Gegensatz zum klassischen Journalisten vergangener Tage, stellen sie von Anfang an ihre Persönlichkeit gleichberechtigt neben ihre Inhalte und glauben auf Dinge wie Überparteilichkeit, Objektivität und sauberes Arbeiten verzichten zu können, so lange sie nur von genug Menschen für ihre unglaublich korrekte Haltung wahrgenommen werden. Da werden Interviewpartner eingeladen, deren Meinung der entsprechende Medienmitarbeiter teilt und ein Interview inszeniert, in dem es keine kritischen Rückfragen gibt. Da ist jede zweite Antwort von Pressevertretern aus dem progressiven Lager auf die Frage nach einem Dialog eine herablassende Floskel wie „Diskurs braucht eine gemeinsame Wissensbasis“, so geht man den lästigen Kritikern gekonnt aus dem Weg, jetzt noch schnell zu Starbucks. Diskussionen mit Kritikern sind so 80er.

Ich habe über die Mona Lisa geschrieben, meine Gedanken drehen sich um Gesundheitsvorsorge, Astrologie und Damen-Cricket / Quelle: Twitter
Und sie gewinnen mit dieser Masche an Einfluss, auch in Deutschland. Schaut man genau hin, finden sich immer wieder die gleichen Namen wenn es darum geht, Videospiele in irgendeinen Kontext mit Rasse oder Geschlecht zu setzen, ob in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder auf Spieleblogs. Manchmal reicht es schon, das jemandem mal ein griffiger Hashtag eingefallen ist oder das er über eine auffällige Frisur verfügt , um in Regierungsgremien eingeladen zu werden oder in diversen Talkshows aufzutreten und daran sicher nicht schlecht zu verdienen. Und wenn man dann erstmal im System ist werden landauf, landab, Woche für Woche Steuergelder und Rundfunkgebühren für Vorträge und ganze Kongresse zum Hype-Thema Netzkultur ausgegeben, auf denen sich dann wieder die gleichen 30 „Speaker_Innen“ treffen wie jedes Wochenende. Eine Monokultur der neuen Ideen. Eigentlich kann man die großzügige Finanzierung der Netzkultur- und der Netzfeminismus-Bewegung als eine Art verlängerten Arm der Arbeitsagentur sehen, der dafür zuständig ist, die nicht ganz so erfolgreichen Kinder der Besserverdienenden zu alimentieren. Und so lange die Kohle vom Patriarchat den Journalistendarstellern für eine Wohnung in Berlin und veganes Liefersushi reicht, stirbt der Videospielejournalismus weiter einen langsamen, qualvollen Tod.
Leute wie TotalBiscuit wird es freuen.